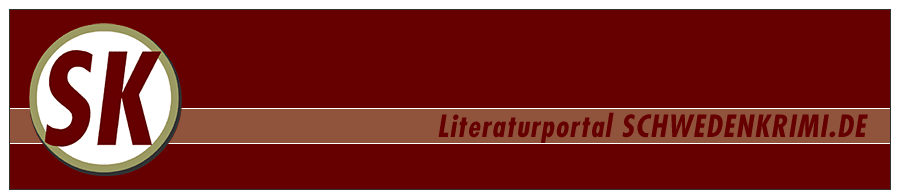Rund 120 Autoren und Autorinnen aus Skandinavien sowie Finnland
und Island sind momentan auf dem deutschen Markt mit Krimis präsent, davon
schätzungsweise 40 allein aus Schweden. Keine Frage, die Krimiwelle aus
dem Norden, die in den letzten Jahren über Deutschland geschwappt ist,
hat deutlich Spuren hinterlassen. Doch zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen.
Für Willy Josefsson beispielsweise, so die Literaturagentin Gudrun Hebel
aus Berlin, fände sich kein deutscher Verlag mehr. Ebbt die Krimiwelle
aus Skandinavien also langsam ab? Möglich. Im Wirtschaftsjargon spricht
man in solch einem Fall wohl von einem "gesättigten" Markt, der
nun in eine "Konsolidierungsphase" tritt, was nichts anderes hieße,
als dass in ein paar Jahren die Quantität der Autoren auf dem deutschen
Markt aus Skandinavien geringer, die Qualität jedoch erwartungsgemäß
höher sein müsse - oder überleben gerade nur die Mainstream-Autoren
und nicht die Autoren, die sich jenseits des Hauptstroms bewegen? Was überhaupt
ist der Mainstream der skandinavischen Krimilandschaft?
Zeit für eine Bestandsaufnahme und einige Thesen zum Boom der Skandinavien-Krimis
in Deutschland!
Wer schwedischer Krimi sagt, muss auch Sjöwall/Wahlöö denken.
An den beiden "Urahnen" des skandinavischen Krimis führt kein
Weg vorbei, seit sie mit ihrem 10-bändigen Romanzyklus um Kommissar Martin
Beck das Krimigenre in den Jahren 1965-1975 revolutionierten und reformierten.
Sjöwall/Wahlöö suchten seinerzeit als überzeugte Marxisten
nach einem Vehikel, mit dem sie eine breite Bevölkerungsschicht erreichen
und zu deren Artikulierung und Politisierung in der gesellschaftlichen Debatte
beitragen konnten. Seitdem ist die gesellschaftskritische Komponente der nordischen
Krimis geradezu zum Markenzeichen avanciert. Zu den Nachfahren des Autorsduos
Sjöwall/Wahlöö zählen heute gemeinhin Autoren wie Henning
Mankell, Liza Marklund, Håkan Nesser, Åke Edwardson oder Anne Holt.
Es besteht kein Zweifel: Der skandinavische Krimi ist zurzeit der politischste
Krimi und stellt das moralische Gewissen Europas dar.
1
Die heutigen Autoren teilen mit Sjöwall/Wahlöö nicht
nur den gesellschaftskritischen Anspruch, sondern mit Ausnahme von Liza
Marklunds Journalistenkrimi handelt es sich bei den Werken der o.g.
Autoren allesamt um Polizeiromane, dem gegenwärtig vorherrschenden
Subgenre.
In diesen Polizeiromanen begegnen uns vor allem Männer, ausgebrannte,
an sich und der Welt verzweifelnde Kommissare - und mit Hanne Wilhelmsen
Kommissarinnen -, geschieden, einsam, eigenbrötlerisch, zuweilen
auch krank und depressiv, doch verzweifeln sie auch noch so sehr, sie
tun stets ihre Pflicht, geben nicht auf und vermitteln so - gewollt
oder ungewollt -, dass sich doch noch alles zum Guten wenden werde.
Gelegentlich brechen sie zwar mit den geltenden Konventionen des Polizeiapparats
(man denke an Wallanders Alleingänge), doch alles in allem halten
sie sich an gängige Spielregeln, um Verbrecher von Weltformat zu
stellen oder um die ganze Welt zu jagen. Bei Mankell gehört es
fast schon zum guten Ton, ein in Schweden verübtes Verbrechen mit
der politischen Situation oder einer Tat in einem anderen Kontinent
zu verbinden, wie die Romane "Die Hunde von Riga", "Die
weiße Löwin" oder zuletzt "Vor dem Frost"
zeigen.
These 1: Internationalisierung - So fern und doch so nah
Damit hat der schwedische Krimi eine Internationalisierung
erlebt, der ihn auch für deutsche Leser interessant macht.
2
Hier sind Autoren, hier sind Kommissare und Kommissarinnen, die uns
verstehen, die unsere Sprache sprechen, die versuchen, die Auswirkungen
der Globalisierung, die im schwedischen Skåne ebenso spürbar
sind wie in der bundesrepublikanischen Gegenwart, zu beschreiben und
verstehbar zu machen. Skandinavische Krimis der Couleur eines Mankell
thematisieren somit die komplexe gesellschaftliche Struktur der Gegenwart
und artikulieren Ängste, Empfindungen und Wahrnehmungen angesichts
der sich rasant verändernden Gegenwart.
Doch auch Autoren wie Olov Svedelid oder Arne Dahl lassen ihre Protagonisten
in einem afrikanischen Gefängnis landen oder schicken sie zur Überführung
eines Serienkillers in die USA. Während bei Svedelid noch mehr
die Action und der Thriller im Stile eines John LeCarré oder
John Grisham im Vordergrund stehen als beispielsweise bei Mankell, kommt
zwar auch bei Arne Dahl die Action nicht zu kurz, doch sind psychologische
Zusammenhänge und Prädispositionen für diesen Autor mindestens
ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger. Damit markiert Svedelid mit Jan
Guillou das eine Ende des schwedischen Polizei- und Agententhrillers
mit viel Action und Dahl das andere, wo psychologische sowie literarische
Muster und Motive für eine Tat eine zentrale Rolle spielen. In
deren Mitte lassen sich Autoren wie Liza Marklund, Henning Mankell oder
Åke Edwardson positionieren, die ebenfalls alle nicht mit Action
und Handlung geizen, jedoch auch - unterschiedlich stark ausgeprägt
und in unterschiedlicher Qualität - das psychologische Moment berücksichtigen.
Zu nennen ist auch Kjell Eriksson, der den schwedischen Polizeiroman
um eine Kommissarin, Ann Lindell, bereichert hat und glaubwürdig
aus der Frauenperspektive erzählt. Doch unterscheidet sich Kjell
Eriksson nicht nur durch seine Wahl für eine Kommissarin. Auch
sein Sprachduktus ist ein gänzlich anderer. Während Mankell,
Marklund & Co. ihre Leser schon mal durchaus in einem - wenngleich
spannenden und mitreißenden - Parforceritt durch den Krimi jagen,
zeichnet sich Eriksson durch stille Momente und poetische Augenblicke
aus - Auch das ist schwedischer Krimi anno 2004!
These 2: Modernität - Schnelle Schnitte, flotte Sprache
Liza Marklunds Journalistin Annika Bengtzon ist nicht die einzige Reporterin,
die auf Verbrechensjagd geht. Das Autorinnentrio Emma Vall (drei Journalistinnen)
hat mit der Figur der Amanda Rönn ebenfalls eine Journalistin ins Krimirennen
geschickt, und in diesem Frühsommer debütiert in Deutschland mit Mari
Jungstedt eine weitere Journalistin als Krimischriftstellerin - man darf gespannt
sein! Liza Marklund schreibt im flotten Magazinstil. Ihre Sprache kommt wie
die ihrer Kollegen Mankell und Edwardson (ebenfalls ehemaliger Journalist) schnell
auf den Punkt, ist journalistisch geprägt, kurz, knapp und prägnant.
Dazu zeichnen sich die Romane durch schnelle Szenenwechsel und schnelle Schnitte,
ähnlich der Filmtechnik, aus.
3 Das macht
sie modern und verleiht ihnen zusätzlich Dynamik.
Die Kulturjournalistinnen Emma Vall erlauben sich zwar einen etwas langsameren
Sprachstil, doch teilen sie mit ihrer Kollegin Liza Marklund neben einer
Journalistin als Protagonistin den gesellschaftskritischen Anspruch,
der bei allen vier Autorinnen so explizit zum Ausdruck kommt, dass er
auch dem unbedarftesten Leser ins Auge springen dürfte.
Diese in aller Deutlichkeit vorgetragene gesellschaftspolitische Position
sowie eine Sprache, die leicht verständlich und damit gut und schnell
in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit lesbar ist - man beachte die im
Haltestellentakt konsumierbaren Kapitel -, hat sicherlich neben der
oben beschriebenen Internationalisierung des schwedischen Krimis zu
seinem rasanten Siegeszug in Deutschland beigetragen.
These 3: Feministische Krimis - Das schwedische Gleichheitsmodell
lockt Leserinnen
Es mag für deutsche Frauen aber auch besonders
attraktiv sein, vom schwedischen (skandinavischen) Gleichheitsmodell
zu lesen, denn die skandinavische Gesellschaft hat es wie keine andere
europäische geschafft, Frauen Berufstätigkeit und Mutterschaft
zu ermöglichen. "Schweden liegt mit seinen weiblichen Krimihelden
weit vorne. Es ist utopisch zu denken, dass eine deutsche Mutter zweier
Kinder auch weiterhin berufstätig ist, wie Annika Bengtzon in Liza
Marklunds Romanen", so die Berliner Literaturagentin Gudrun Hebel.
Auch die Finnin Leena Lehtolainen bedient mit ihrer Protagonistin Maria
Kallio den "feministischen", den "Frauenkrimi",
und die Dänin Gretelise Holm wurde sogar von ihrem Verlag dazu
aufgefordert, einen "Frauenkrimi", "einen Krimi und einen
sozialkritischen Gegenwartsroman" zu schreiben.
4
Der Erfolg scheint ihr und dem Verlag Recht zu geben. Auch Emma Vall
bedienen dieses Marktsegment: "Wir schreiben feministische Nach-dem-Volksheim-Krimis",
so die Autorinnen selbst. Denkwürdig: Kjell Eriksson mit seiner
allein erziehende Kommissarin Ann Lindell entpuppt sich damit auch in
dieser Hinsicht als Grenzgänger und lehrt uns in Katalogisierungen
denkenden Deutschen, dass feministische oder Frauenkrimis nicht unbedingt
von Frauen geschrieben sein müssen und Schubladendenken eigentlich
eh obsolet sein sollte.
These 4: Der psychologische Krimi - Ein immer stärker werdender
Nebenstrom
Doch eine letzte, kleine, aber feine Schublade soll noch aufgemacht
werden. Hier finden sich Autorinnen wie die Norwegerin Karin Fossum sowie
die Schwedinnen Karin Alvtegen und Liselott Willén. Bemerkenswert
an diesen Autorinnen ist, dass ihre Romane vielmehr psychologischen Charakterstudien
5
gleichen, und das psychologische Moment zugleich Ausgangspunkt für
die Story ist. Insbesondere Liselott Willén überschreitet
mit ihrem Debütroman "Stein um Stein" raffiniert die Genreregeln
und lässt "Stein um Stein" genau dort enden, wo andere
Krimis eigentlich erst anfangen - wenn sie nicht gleich ganz einen moralischen
(Selbst-)Mord begeht.
Auch Karin Alvtegen verweigert sich mit ihren bisher drei Romanen "Schuld",
"Die Flüchtige" und "Der Seitensprung" insofern
den Regeln, als sie weder einen Kommissar, noch einen Privatdetektiv oder
eine Journalistin zum Hauptcharakter macht noch überhaupt einen konstanten
Protagonisten schafft und den "Seitensprung" ähnlich Liselott
Willéns "Stein um Stein" dort beendet, wo ein Kommissar
überhaupt erst auf den Plan treten könnte. Das Ende gerade dieses
Romans gestaltet Karin Alvtegen dabei so leise und perfide, dass kein
noch so actionreicher und grausamer Mankell oder Edwardson damit mithalten
kann, doch hält ihre Personenzeichnung - im Vergleich zu Karin Fossum
etwa - einem langsamen und reflektierenden Lesen nicht immer Stand.
Karin Fossum kann damit als unangefochtene Meisterin der psychologischen
Charakterstudie auf engstem Raum und in der Beschreibung von Außenseitern,
Tätern, Opfern und ihrem Beziehungsgeflecht untereinander gelten.
Bei ihr bleibt immer ein "ungeklärter Rest" zurück,
der den Leser zwingt, die gerade scheinbar so logisch und eindeutig erbrachte
Klärung des Falls durch Kommissar Sejer zu hinterfragen und nach
Handlungsalternativen des Individuums zu suchen. Sie entschuldigt Täter
nicht einfach damit, selbst Opfer zu sein, sondern verweist leise immer
wieder auf die Eigenverantwortlichkeit eines jeden Menschen. Kommissar
Sejer hält sich dabei stets denkbar leise im Hintergrund und überlässt
die Szene Tätern und Opfern, was diese Romane unter den Polizeiromanen
deutlich heraushebt.
These 5: Political Correctness - Das deutsche Problem mit dem Deutschen
Diese Vielfalt und das Facettenreichtum der schwedischen
und skandinavischen Krimilandschaft macht es sicherlich möglich,
dass jeder Krimifan nach seinem Geschmack fündig werden kann. Facettenreichtum
und Vielfalt zeugen sicher auch von einem hohen Qualitätsbewusstsein
der Autoren, doch ist das keine hinreichende Erklärung dafür,
warum die Autoren und Autorinnen aus dem Norden Europas in Deutschland
so große Erfolge feiern, denn ihre Romane erscheinen auch in anderen
europäischen Ländern, doch scheinen die Erfolge auf dem deutschen
Markt alle anderen zu übertreffen.
Sind angelsächsische, deutsche oder französische Krimis so
viel schlechter als die skandinavischen? Sicher nicht, doch scheint
das Bedürfnis nach Orientierung, nach Antworten und Lösungsvorschlägen
auf die globalisierte Gegenwart zurzeit besonders ausgeprägt zu
sein, und die Skandinavier bieten wie oben beschrieben momentan die
politischsten Krimis. Und bei aller Kritik: Diese sind politisch korrekt.
Gesellschaft, Staat und Regierung zu kritisieren, Rassismus und Wirtschaftskriminalität
zu kritisieren, ist in hohem Maße politisch korrekt. Mehr noch:
Die politische und gesellschaftliche Kritik wie sie in den skandinavischen
Krimis vorgetragen wird, bewegt sich innerhalb gesellschaftlich etablierter
Konventionen. Ebendiese haben Sjöwall/Wahlöö ja seinerzeit
begründet. Darum hat Mankell auch nicht den Krimi revolutioniert
oder Innovatives hervorgebracht. Der Weg war ja vielmehr durch Sjöwall/Wahlöö
bereits geebnet. Mankell und andere Epigonen Sjöwall/Wahlöös
haben dieses Feld "lediglich" neu, d.h. zeitgemäß,
bestellt.
Damit treffen sie offensichtlich den Nerv einer ganzen Generation einer
Bundesrepublik Deutschland, die gegenüber dem großen Verbündeten
und - politischen, kulturellen… - Vorbild USA zunehmend selbstbewusster
und emanzipierter agiert. Die Alt-68er und die "Lieber Petting
statt Pershing"-Generation ist in der Gesellschaft, ist im Establishment
angekommen, und das nicht nur im politischen Bereich.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass eine zu starke Orientierung
an "Deutschem" nach wie vor tabuisiert ist, ebenso wie eine
kritischere Distanz zu den USA und ihren Wertvorstellungen zunehmend
stärker artikuliert wird. Das heißt, es ist nicht mehr möglich,
sich vorbehaltlos am American Way of Life zu orientieren. Und damit
befinden wir uns in einem Dilemma: An "Deutschem" mögen
wir uns immer noch nicht so recht als "Leitbild" orientieren,
am American Way of Life aber auch nicht mehr. Auch bietet ja die angelsächsische
Krimiliteratur bei weitem nicht den Grad an Politisierung wie die skandinavische
- und Michael Moore schreibt nun mal keine Krimis! Damit bleiben die
Skandinavier de facto die einzige Alternative für viele der heutigen
30 - 50jährigen, sich politisch korrekt und ruhigen Gewissens kritischer
Gegenwartsliteratur zuzuwenden und ihr - wenn auch nicht explizit gedacht
oder ausgesprochen - eine Leitbildfunktion zuzusprechen.
These 6: Die Krise der zeitgenössischen Literatur - Eine Generation
ohne Literatur?
Aber Moment, was heißt hier "kritische Gegenwartsliteratur"
und "Leitbildfunktion"? Hat die zeitgenössische Literatur keine
Antworten auf die drängenden Fragen der Menschen mehr zu geben? Stellen
wir die Frage anders: Was hat das deutsche Feuilleton in den letzten Jahren
nachhaltig aufgeregt? Da fallen einem sofort die Romane "Im Krebsgang"
von Günter Grass und "Tod eines Kritikers" von Martin Walser
ein - beide Jahrgang 1927! Günter Grass' Roman "Im Krebsgang"
ist sicherlich ein wichtiges Werk, aber einmal mehr geht es um die Vergangenheit
und damit nur bedingt auch um Gegenwart und Zukunft.
Und was machen die jüngeren Autoren? Sie beglücken uns mit Werken
wie "Generation Golf" und "Generation Golf 2" von Florian
Illies. Das ist nicht wirklich politisch und greift auch nicht die drängenden
Fragen der Zeit auf, wie es die Skandinavier in ihren Krimis tun. Auch Autorinnen
wie Claudia Rusch ("Meine Freie Deutsche Jugend"), Jana Hensel ("Zonenkinder")
oder Katja Oskamp ("Halbschwimmer") sowie ihre westdeutschen Pendants
Gerhard Henschel und Marcus Jensen (Kindheitsroman bzw. Oberland) machen es
sich mit ihren Werken in der allgemeinen (N)Ostalgie-Kuschelecke bequem, und
alle Thirty-Somethings der wiedervereinigten BRD dürfen jetzt in Kindheitserinnerungen
schwelgen. Das ist nett. Das ist schön. Aber Werke wie diese geben damit
noch lange keine Antworten und Orientierungen für das Hier und Jetzt.
Sie stellen noch nicht einmal die richtigen Fragen auf das Hier und Jetzt.
Damit bleiben die Krimis des Nordens Europas "die einzige Form von Literatur
(…), in der noch moralische Fragen behandelt werden können (…)"
6,
die einzige literarische Gattung, die mit ihren Gestaltungsformen die enorme
Komplexität der postmodernen, globalisierten Gesellschaft sowie ihre
undurchschaubaren Machtstrukturen noch etwas sichtbar und begreifbar machen
kann.
7